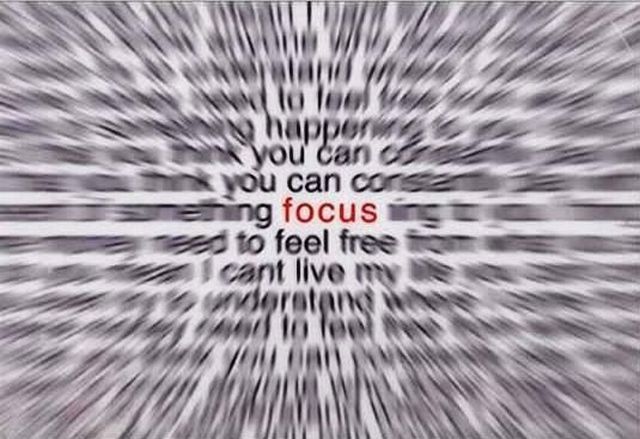Das Interessante an alten Hunden ist: Einige von ihnen sind wirklich gut darin, neue Tricks zu lernen. Für "alte Medien" gilt das auch. (Meist deshalb, weil der Trick eigentlich nicht neu ist, sondern nur seine Adaption.) Oft genug geht, wenn es um die Zukunft des Journalismus geht, der Blick zu Traditionstiteln. Zur grauen Lady New York Times. Zum britischen Guardian. Im deutschsprachigen Raum auch zur Zeit oder zur alten Tante NZZ.
Und wenn es um die Zukunft von TV sowie die Verbindung von Mattscheibe und Netz geht, dann ist die BBC definitiv einen Blick wert. Die Art, wie the Beep für Formate wie Sherlock, Doctor Who oder Top Gear das Publikum im Netz umgarnt, könnte für ein paar elementare Erkenntnisse gut sein.
Am besten sichtbar wird dieses Vorgehen sogar bei Formaten, die an und für sich alt sind. Jüngstes Beispiel stellen die Promotion-Maßnahmen rund um den Start der dritten Staffel von Sherlock dar - eine in die Gegenwart übertragene Neuadaption des klassischen Detektivs. Nach zwei Jahren Sendepause muss man schon mal auf die nächste Ausstrahlung aufmerksam machen. Und der BBC gelingt das weltweit mit ein paar Clips. Nach Teasern und Trailern folgte kürzlich mit der Kurz-Webisode Many Happy Returns der Höhepunkt. Ein knapp siebenminütiges Prequel zur ersten Folge der neuen Staffel, die zu Neujahr fällig ist.
Nicht billig geschraubt, nicht achtlos hingeschmissenes "irgendwie müssen wir das Publikum ja bei Laune halten"-Material, sondern vom selben Team als detailliert durchkonzipierte Geschichte in guter Weblänge hochwertig produziert.
Und viral genug, dass der Siebenminüter mir mehrfach in meinen Streams begegnete, auf Facebook, Twitter oder Medienplattformen. So geht Content Marketing.
Am besten sichtbar wird dieses Vorgehen sogar bei Formaten, die an und für sich alt sind. Jüngstes Beispiel stellen die Promotion-Maßnahmen rund um den Start der dritten Staffel von Sherlock dar - eine in die Gegenwart übertragene Neuadaption des klassischen Detektivs. Nach zwei Jahren Sendepause muss man schon mal auf die nächste Ausstrahlung aufmerksam machen. Und der BBC gelingt das weltweit mit ein paar Clips. Nach Teasern und Trailern folgte kürzlich mit der Kurz-Webisode Many Happy Returns der Höhepunkt. Ein knapp siebenminütiges Prequel zur ersten Folge der neuen Staffel, die zu Neujahr fällig ist.
Nicht billig geschraubt, nicht achtlos hingeschmissenes "irgendwie müssen wir das Publikum ja bei Laune halten"-Material, sondern vom selben Team als detailliert durchkonzipierte Geschichte in guter Weblänge hochwertig produziert.
Und viral genug, dass der Siebenminüter mir mehrfach in meinen Streams begegnete, auf Facebook, Twitter oder Medienplattformen. So geht Content Marketing.
 |
| Bild: Screenshot. |